Alternativen. Oder: Von Rittern und Räubern
"In einem Dorf desselben Kreises ist jüngst eine Maschine aufgestellt worden, die pro Minute 200 Kugelschreiber automatisch herstellt. Wenn diese Maschine – Wartungszeiten eingerechnet – eineinhalb Jahre läuft, dann haben die daran im Dreischichtsystem arbeitenden drei Frauen aus meiner Nachbarschaft jeden Bundesbürger mit einem Schreiber versorgt. Gesellschaftlich sinnvoll organisiert könnten sie nach diesem anstrengendem Jahr ihre Tätigkeit für das Reich der Notwendigkeiten einstellen und sich wichtigeren Dingen wie Kindererziehung, Beziehungsfragen, Kultur und Kunst widmen.
Weil aber die Gesellschaft (noch) nicht vernünftig organisiert ist, dürfen sie das nicht. Denn unter kapitalistischen Bedingungen ereignet sich Arbeitszeitverkürzung ungleichmäßig – fünf bis zehn Millionen werden ausgesperrt, und der Rest soll länger, nicht kürzer arbeiten.
Der oft bemühte Vergleich mit der Weimarer Republik zeigt bei genauerem Hinsehen Weiteres. Die Verzweiflung war damals auch deshalb so groß, weil die von Lohnersatzleistungen betroffenen Familien in relativ kurzer Zeit tatsächlich vom Hungertod bedroht waren. Die jetzt erreichte Produktivität ermöglicht es, ohne größere Probleme – vernünftige gesellschaftliche Organisation wieder vorausgesetzt – fünf, zehn oder sogar 15 Millionen Menschen in diesem Land zusätzlich zu den Kindern und Alten zu ernähren, zu bekleiden und ihnen Wohnungen und Autos zu bauen, ohne daß sie selbst mithelfen müßten, Getreide zu pflanzen, zu ziegeln oder zu schrauben." (Der Artikel)
Siehe dazu:
Bedingungsloses Grundeinkommen - In Freiheit tätig sein
Weil aber die Gesellschaft (noch) nicht vernünftig organisiert ist, dürfen sie das nicht. Denn unter kapitalistischen Bedingungen ereignet sich Arbeitszeitverkürzung ungleichmäßig – fünf bis zehn Millionen werden ausgesperrt, und der Rest soll länger, nicht kürzer arbeiten.
Der oft bemühte Vergleich mit der Weimarer Republik zeigt bei genauerem Hinsehen Weiteres. Die Verzweiflung war damals auch deshalb so groß, weil die von Lohnersatzleistungen betroffenen Familien in relativ kurzer Zeit tatsächlich vom Hungertod bedroht waren. Die jetzt erreichte Produktivität ermöglicht es, ohne größere Probleme – vernünftige gesellschaftliche Organisation wieder vorausgesetzt – fünf, zehn oder sogar 15 Millionen Menschen in diesem Land zusätzlich zu den Kindern und Alten zu ernähren, zu bekleiden und ihnen Wohnungen und Autos zu bauen, ohne daß sie selbst mithelfen müßten, Getreide zu pflanzen, zu ziegeln oder zu schrauben." (Der Artikel)
Siehe dazu:
Bedingungsloses Grundeinkommen - In Freiheit tätig sein
Morgaine - 11. Jul, 12:04
4 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
kinomu - 11. Jul, 23:26
Was hindert den "junge Welt"-Ökonomen daran, mit eigenem Erspartem, mit Gleichgesinnten, mit einem Kredit selbst eine Kugelschreiberproduktionsmaschine zu kaufen, sie eineinhalb Jahre laufen zu lassen und sich dann zur Ruhe zu setzen? wichtigeren Dingen wie Kindererziehung, Beziehungsfragen, Kultur und Kunst zu widmen? Er könnte den Lohn der Arbeiterinnen erhöhen, ihre Arbeitszeit verkürzen und zusätzlich noch 1, 2 Leuten ein Grundeinkommen zahlen und ihnen Wohnungen bauen, ohne dass diese arbeiten müssten. Er könnte zeigen, wie man vernünftig organisiert. Er würde berühmt werden.
Morgaine - 12. Jul, 12:20
Zwei Fragen, die Sie hier ansprechen:
a) die Aufgabe von Journalisten
b) Arbeitszeitverkürzung
ad a)
Entscheidet sich jemand für diesen Beruf, so *sollte* doch seine Aufgabe unter anderem darin liegen, zu analysieren und bei Bedarf nach Alternativen zu suchen, diese dann vorzustellen, damit *andere* sie umsetzen können -schlichte Arbeitsteilung also.
ad b)
Die Effektivität maschineller Produktion wird immer besser, der durch diese Maschinen erzielte mögliche! Umsatz größer. Auf der anderen Seite haben wir Arbeit, die nicht durch Maschinen ersetzbar ist, die oben bereits in Teilen aufgeführte Beziehungsarbeit. Eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn das Verhältnis von Produktion und Beziehungsarbeit in einem ausgeglichenen Verhältnis steht. Genau daran aber mangelt es momentan unter anderem: Gesättigte Märkte, keine Arbeitszeitverkürzung aufgrund gestiegener Produktionsrate, gleichbleibende bzw. steigende Beziehungsarbeit. Der Artikel verdeutlicht an einem Beispiel, wie dieses Missverhältniss zugunsten dringend notwendiger gesellschaftlicher Beziehungsarbeit verändert werden könnte.
Nach den Ergebnissen meiner Recherche war übrigens die erste, die erfolgreich in Richtung des genannten Modells mit ihrer Firmenpolitik gingen, die Firma Kelloggs. Im Google-Cache fand ich folgendes Zitat aus meinem eigenen, seit Oktober 2003 bestehenden Weblog Anoteron, das ich leider im letzten Jahr aufgrund massiven auf mich ausgeübten Drucks nach der Veröffentlichung von "Generation Blogger" *vorläufig* vollständig gelöscht habe:
"Dass man mit Arbeitszeitverkürzung ein sehr erfolgreiches Unternehmen sein kann, zeigt folgendes Beispiel:
http://www.symposion.de/arbeitszeit/az_05.htm
In der Hochphase der Industrialisierung traten selbst die Arbeitgeber für kürzere Arbeitszeiten ein – nicht, weil sie von besonderem Idealismus beseelt waren, sondern weil sie überzeugt waren, dass Überarbeitung und Müdigkeit Schaden anrichteten und dass Sicherheit, Ruhe und ein Minimum an Familienleben sich auf lange Sicht auszahlen würden. Die Folge war ein allmähliches und stetiges Sinken der Arbeitszeiten in den Vereinigten Staaten während der gesamten zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und eine einschneidende Kürzung – von zehn Stunden auf acht Stunden am Tag – in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. 1930 kündigte der Wirtschaftsvisionär W. K. Kellog (der von den Cornflakes) ein revolutionäres Experiment an: Nahezu alle Beschäftigten seines riesigen Unternehmens in Battle Creek sollten ab sofort nur noch sechs Stunden am Tag arbeiten. Die Verringerung der Arbeitsstunden wurde nur von minimalen Lohnkürzungen begleitet, weil Kellogg glaubte, dass eifrige Arbeit den Ausfall der Stunden wettmachen würde. Dieses Programm war ein sofortiger Erfolg. Eine typische Reaktion war etwa die Erklärung eines Wirtschaftsmagazins auf der Titelseite, dies sei »die größte Neuerung in der Industrie seit Fords Fünf-Dollar-pro-Tag-Politik«. Fast zwanzig Jahre lang funktionierte Kelloggs Konzept hervorragend. Nach dem Zweiten Weltkrieg hofften die Arbeiter, aus dem Konsumaufschwung des Landes in der Nachkriegszeit Profit zu ziehen, und forderten einen Achtstundentag. In den fünfziger und sechziger Jahren bewegten sich die Beschäftigten von Kellog stetig auf einen Achtstundentag zu. 1985 gaben die noch verbliebenen Verfechter der alten Regelung, von denen drei Viertel Frauen waren, auf.
Quelle: Robert Levine;
Eine Landkarte der Zeit: Wie Kulturen mit Zeit umgehen; Piper; 1997
a) die Aufgabe von Journalisten
b) Arbeitszeitverkürzung
ad a)
Entscheidet sich jemand für diesen Beruf, so *sollte* doch seine Aufgabe unter anderem darin liegen, zu analysieren und bei Bedarf nach Alternativen zu suchen, diese dann vorzustellen, damit *andere* sie umsetzen können -schlichte Arbeitsteilung also.
ad b)
Die Effektivität maschineller Produktion wird immer besser, der durch diese Maschinen erzielte mögliche! Umsatz größer. Auf der anderen Seite haben wir Arbeit, die nicht durch Maschinen ersetzbar ist, die oben bereits in Teilen aufgeführte Beziehungsarbeit. Eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn das Verhältnis von Produktion und Beziehungsarbeit in einem ausgeglichenen Verhältnis steht. Genau daran aber mangelt es momentan unter anderem: Gesättigte Märkte, keine Arbeitszeitverkürzung aufgrund gestiegener Produktionsrate, gleichbleibende bzw. steigende Beziehungsarbeit. Der Artikel verdeutlicht an einem Beispiel, wie dieses Missverhältniss zugunsten dringend notwendiger gesellschaftlicher Beziehungsarbeit verändert werden könnte.
Nach den Ergebnissen meiner Recherche war übrigens die erste, die erfolgreich in Richtung des genannten Modells mit ihrer Firmenpolitik gingen, die Firma Kelloggs. Im Google-Cache fand ich folgendes Zitat aus meinem eigenen, seit Oktober 2003 bestehenden Weblog Anoteron, das ich leider im letzten Jahr aufgrund massiven auf mich ausgeübten Drucks nach der Veröffentlichung von "Generation Blogger" *vorläufig* vollständig gelöscht habe:
"Dass man mit Arbeitszeitverkürzung ein sehr erfolgreiches Unternehmen sein kann, zeigt folgendes Beispiel:
http://www.symposion.de/arbeitszeit/az_05.htm
In der Hochphase der Industrialisierung traten selbst die Arbeitgeber für kürzere Arbeitszeiten ein – nicht, weil sie von besonderem Idealismus beseelt waren, sondern weil sie überzeugt waren, dass Überarbeitung und Müdigkeit Schaden anrichteten und dass Sicherheit, Ruhe und ein Minimum an Familienleben sich auf lange Sicht auszahlen würden. Die Folge war ein allmähliches und stetiges Sinken der Arbeitszeiten in den Vereinigten Staaten während der gesamten zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und eine einschneidende Kürzung – von zehn Stunden auf acht Stunden am Tag – in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. 1930 kündigte der Wirtschaftsvisionär W. K. Kellog (der von den Cornflakes) ein revolutionäres Experiment an: Nahezu alle Beschäftigten seines riesigen Unternehmens in Battle Creek sollten ab sofort nur noch sechs Stunden am Tag arbeiten. Die Verringerung der Arbeitsstunden wurde nur von minimalen Lohnkürzungen begleitet, weil Kellogg glaubte, dass eifrige Arbeit den Ausfall der Stunden wettmachen würde. Dieses Programm war ein sofortiger Erfolg. Eine typische Reaktion war etwa die Erklärung eines Wirtschaftsmagazins auf der Titelseite, dies sei »die größte Neuerung in der Industrie seit Fords Fünf-Dollar-pro-Tag-Politik«. Fast zwanzig Jahre lang funktionierte Kelloggs Konzept hervorragend. Nach dem Zweiten Weltkrieg hofften die Arbeiter, aus dem Konsumaufschwung des Landes in der Nachkriegszeit Profit zu ziehen, und forderten einen Achtstundentag. In den fünfziger und sechziger Jahren bewegten sich die Beschäftigten von Kellog stetig auf einen Achtstundentag zu. 1985 gaben die noch verbliebenen Verfechter der alten Regelung, von denen drei Viertel Frauen waren, auf.
Quelle: Robert Levine;
Eine Landkarte der Zeit: Wie Kulturen mit Zeit umgehen; Piper; 1997
kinomu - 13. Jul, 06:56
ad a)
Möglicherweise wurde meine Ironie diesmal nicht erkannt... ich meine, dass der Journalist zwar gut ist im Reproduzieren marxistischer Phrasen, aber von Wirtschaft keine Ahnung hat, denn: die Tatsache, dass eine Maschine (subjektiv) viel produziert, sagt nichts darüber aus, ob sich mit ihrem Betrieb etwas verdienen lässt. Dazu muss man wissen, wie viel die Maschine kostet, Grundstück, Rohstoffe, Arbeitszeit, Marketing etc.pp und zu welchem Preis die Kugelschreiber verkauft werden. Möglicherweise sind sogar die variablen Kosten pro Kugelschreiber höher als der Verkaufspreis und die Produktion wird nur deshalb aufrechterhalten, weil der Produzent durch langfristige Verträge gebunden ist, aus denen auszusteigen teurer wäre als der durch die Produktion entstehende Verlust. Oder der Break Even Point liegt bei 300 Stück pro Minute...
ad b)
1. "Der Artikel verdeutlicht an einem Beispiel, wie dieses Missverhältnis zugunsten dringend notwendiger gesellschaftlicher Beziehungsarbeit verändert werden könnte."
Über das wie habe ich nichts gefunden. Denn "Entscheidend ist, unter jetzigen Bedingungen Formen zu finden, um das Gemeineigentum gegenüber dem Privateigentum an Produktionsmitteln wieder in die Offensive zu bringen." - mit anderen Worten: Enteignung - halte ich nicht für eine akzeptable Lösung. Viele historische Beispiele zeigen, dass das auch kein Nullsummenspiel wäre. (ZB Zimbabwe: nach der Enteignung der weissen Farmer sank die Lebensmittelproduktion stark, der Wohlstand des Grossteils der Bevölkerung hat sich verschlechtert. Heute werden die Armen verfolgt, weil sie - aus gutem Grund - die Opposition unterstützen. Oder Nationalsozialismus: viele der arisierten Betriebe gingen rasch zugrunde, weil die sie Übernehmenden unfähig waren. In solchen Situationen setzen sich nicht die ethisch geeignetsten und begabtesten, sondern die Skrupellosesten durch.)
2. "Beziehungsarbeit" ist ein Wort, das mir überhaupt nicht gefällt. Das fühlt sich zu materialistisch an. So, als versuchte jemand, für den Erwerbsarbeit an sich sinnvoll und ethisch wertvoll ist, die für eine Beziehung aufgewandte Zeit zu rechtfertigen. Motto: "Es ist Arbeit, also ist es keine Zeitverschwendung."
3. Über Herrn Kellogg hab ich schon mal gelesen - hat er sich nicht auch stark für die (nicht betriebsnotwendige) Bildung seiner Mitarbeiter, deren Gesundheit etc. eingesetzt? Ziemlich paternalistisch. (Soll keine Kritik sein.)
4. Arbeitszeitverkürzung - aufgrund von Überarbeitung kam es oft zu Schäden an (teuren) Maschinen und zu (für die Firmen) teurer Invalidität.
Bei manchen Tätigkeiten ist es ein Vorteil, wenn die Arbeit auf mehrere ausgeruhte Mitarbeiter aufgeteilt wird (zb Callcenter, insbesondere Outbound-Telefonate: körperlich (Stimme) und psychisch anstrengend), in anderen Bereichen ist das nicht gut möglich, weil zb qualifiziertes Personal fehlt oder die Koordination sehr aufwändig wäre (zb Management Consulting).
Möglicherweise wurde meine Ironie diesmal nicht erkannt... ich meine, dass der Journalist zwar gut ist im Reproduzieren marxistischer Phrasen, aber von Wirtschaft keine Ahnung hat, denn: die Tatsache, dass eine Maschine (subjektiv) viel produziert, sagt nichts darüber aus, ob sich mit ihrem Betrieb etwas verdienen lässt. Dazu muss man wissen, wie viel die Maschine kostet, Grundstück, Rohstoffe, Arbeitszeit, Marketing etc.pp und zu welchem Preis die Kugelschreiber verkauft werden. Möglicherweise sind sogar die variablen Kosten pro Kugelschreiber höher als der Verkaufspreis und die Produktion wird nur deshalb aufrechterhalten, weil der Produzent durch langfristige Verträge gebunden ist, aus denen auszusteigen teurer wäre als der durch die Produktion entstehende Verlust. Oder der Break Even Point liegt bei 300 Stück pro Minute...
ad b)
1. "Der Artikel verdeutlicht an einem Beispiel, wie dieses Missverhältnis zugunsten dringend notwendiger gesellschaftlicher Beziehungsarbeit verändert werden könnte."
Über das wie habe ich nichts gefunden. Denn "Entscheidend ist, unter jetzigen Bedingungen Formen zu finden, um das Gemeineigentum gegenüber dem Privateigentum an Produktionsmitteln wieder in die Offensive zu bringen." - mit anderen Worten: Enteignung - halte ich nicht für eine akzeptable Lösung. Viele historische Beispiele zeigen, dass das auch kein Nullsummenspiel wäre. (ZB Zimbabwe: nach der Enteignung der weissen Farmer sank die Lebensmittelproduktion stark, der Wohlstand des Grossteils der Bevölkerung hat sich verschlechtert. Heute werden die Armen verfolgt, weil sie - aus gutem Grund - die Opposition unterstützen. Oder Nationalsozialismus: viele der arisierten Betriebe gingen rasch zugrunde, weil die sie Übernehmenden unfähig waren. In solchen Situationen setzen sich nicht die ethisch geeignetsten und begabtesten, sondern die Skrupellosesten durch.)
2. "Beziehungsarbeit" ist ein Wort, das mir überhaupt nicht gefällt. Das fühlt sich zu materialistisch an. So, als versuchte jemand, für den Erwerbsarbeit an sich sinnvoll und ethisch wertvoll ist, die für eine Beziehung aufgewandte Zeit zu rechtfertigen. Motto: "Es ist Arbeit, also ist es keine Zeitverschwendung."
3. Über Herrn Kellogg hab ich schon mal gelesen - hat er sich nicht auch stark für die (nicht betriebsnotwendige) Bildung seiner Mitarbeiter, deren Gesundheit etc. eingesetzt? Ziemlich paternalistisch. (Soll keine Kritik sein.)
4. Arbeitszeitverkürzung - aufgrund von Überarbeitung kam es oft zu Schäden an (teuren) Maschinen und zu (für die Firmen) teurer Invalidität.
Bei manchen Tätigkeiten ist es ein Vorteil, wenn die Arbeit auf mehrere ausgeruhte Mitarbeiter aufgeteilt wird (zb Callcenter, insbesondere Outbound-Telefonate: körperlich (Stimme) und psychisch anstrengend), in anderen Bereichen ist das nicht gut möglich, weil zb qualifiziertes Personal fehlt oder die Koordination sehr aufwändig wäre (zb Management Consulting).
Morgaine - 14. Jul, 17:29
- Dass die Kugelschreiber-Produktion nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn erzielt, sollte in diesem Modell schon vorausgesetzt werden. Die Frage, wie und ob dieser Gewinn in einer kreativen Bilanz ausgewiesen wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
- Eine Offensive des Gemeineigentums gegenüber dem Eigentum an Produktionsmitteln muss nicht unbedingt Enteignung heißen, es sei denn, man verbleibt in der Tat bei (marxistischer) Ideologie. Ich denke da zum Beispiel an eine prozentuale Beteiligung ähnlich dem Gedanken des Bruttoeinkommens beim Ulmer Modell, das die Finanzierung eines Grundeinkommens für alle BürgerInnen vorsieht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundeinkommen
Weitere Informationen zum Thema Grundeinkommen siehe in meinem Beitrag "Bedingungsloses Grundeinkommen - In Freiheit tätig sein"
http://morgaine.twoday.net/stories/824486/
- Auf das Beispiel Zimbabwe möchte ich hier nicht eingehen, nur grundsätzlich anmerken, dass man Selbstständigkeit nicht von heute auf morgen lernt. Südafrika hat da nach meiner Kenntnis einen sehr guten Lernprozess durchlaufen.
- Dass das Wort Beziehungsarbeit keine glückliche Formulierung ist, finde ich auch. Nur ist sie in einer Zeit zwingend notwendig, in der Zeit mit Geld gleichgesetzt wird. Die Triade heißt Arbeit, Zeit, Geld. Die Pflege von Beziehungen gleich welcher Art braucht Zeit, Kindererziehung braucht Zeit. Zeit wird im ausufernden Kapitalismus in Geld gemessen. Um die Wertschätzung von Beziehungen zu verdeutlichen, muß halt (noch?) daraufhin gewiesen werden, wieviel Zeit für Beziehungen notwendig sind, und wieviel Geld mit dieser Zeit verdient werden kann. Oder: Kinder erzieht man nicht zwischen Tür und Angel und in den Kleiderschrank kann man sie auch nicht stopfen. Dasselbe gilt für Beziehungen unter Erwachsenen.
- Paternalistische Unternehmensführungen sind dann in der Tat ärgerlich, wenn beispielsweise argumentiert wird, der Betriebsrat sei überflüssig, weil "Papi" schon genügend für das Wohl seiner Lieben sorge. Papi erzählt den Kleinen, wo es lang geht? Birkenstock hat damit auch schon mal Schiffbruch erlitten.
- Arbeitszeitverkürzung ist eine Frage der Organisation. Erst gestern habe ich wieder von einem erfolgreichen Modell im Bereich der öffentlichen Gesundheitssorge gehört. MitarbeiterInnen, in diesem Fall SozialarbeiterInnen, werden auf Zielvorgaben festgelegt, es zählt also der Erfolg, nicht das Bemühen. Erfolg ist die Integration eines psychisch Kranken in ein normales Leben. Im sogenannten "Solinger Modell" führte dies zu kürzerer Arbeitszeit und kürzerer Erkrankungszeit der Klienten. Etwas sarkastisch formuliert könnte ich jetzt auch sagen, dass der Mutterkomplex doch lieber nicht an den Klienten abgearbeitet werden sollte ...
Generell stellt sich die Frage, ob Zielvorgaben nicht effektiver sind als Zeitvorgaben. Dass dieses nicht überall umsetzbar ist, steht außer Frage.
- Eine Offensive des Gemeineigentums gegenüber dem Eigentum an Produktionsmitteln muss nicht unbedingt Enteignung heißen, es sei denn, man verbleibt in der Tat bei (marxistischer) Ideologie. Ich denke da zum Beispiel an eine prozentuale Beteiligung ähnlich dem Gedanken des Bruttoeinkommens beim Ulmer Modell, das die Finanzierung eines Grundeinkommens für alle BürgerInnen vorsieht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundeinkommen
Weitere Informationen zum Thema Grundeinkommen siehe in meinem Beitrag "Bedingungsloses Grundeinkommen - In Freiheit tätig sein"
http://morgaine.twoday.net/stories/824486/
- Auf das Beispiel Zimbabwe möchte ich hier nicht eingehen, nur grundsätzlich anmerken, dass man Selbstständigkeit nicht von heute auf morgen lernt. Südafrika hat da nach meiner Kenntnis einen sehr guten Lernprozess durchlaufen.
- Dass das Wort Beziehungsarbeit keine glückliche Formulierung ist, finde ich auch. Nur ist sie in einer Zeit zwingend notwendig, in der Zeit mit Geld gleichgesetzt wird. Die Triade heißt Arbeit, Zeit, Geld. Die Pflege von Beziehungen gleich welcher Art braucht Zeit, Kindererziehung braucht Zeit. Zeit wird im ausufernden Kapitalismus in Geld gemessen. Um die Wertschätzung von Beziehungen zu verdeutlichen, muß halt (noch?) daraufhin gewiesen werden, wieviel Zeit für Beziehungen notwendig sind, und wieviel Geld mit dieser Zeit verdient werden kann. Oder: Kinder erzieht man nicht zwischen Tür und Angel und in den Kleiderschrank kann man sie auch nicht stopfen. Dasselbe gilt für Beziehungen unter Erwachsenen.
- Paternalistische Unternehmensführungen sind dann in der Tat ärgerlich, wenn beispielsweise argumentiert wird, der Betriebsrat sei überflüssig, weil "Papi" schon genügend für das Wohl seiner Lieben sorge. Papi erzählt den Kleinen, wo es lang geht? Birkenstock hat damit auch schon mal Schiffbruch erlitten.
- Arbeitszeitverkürzung ist eine Frage der Organisation. Erst gestern habe ich wieder von einem erfolgreichen Modell im Bereich der öffentlichen Gesundheitssorge gehört. MitarbeiterInnen, in diesem Fall SozialarbeiterInnen, werden auf Zielvorgaben festgelegt, es zählt also der Erfolg, nicht das Bemühen. Erfolg ist die Integration eines psychisch Kranken in ein normales Leben. Im sogenannten "Solinger Modell" führte dies zu kürzerer Arbeitszeit und kürzerer Erkrankungszeit der Klienten. Etwas sarkastisch formuliert könnte ich jetzt auch sagen, dass der Mutterkomplex doch lieber nicht an den Klienten abgearbeitet werden sollte ...
Generell stellt sich die Frage, ob Zielvorgaben nicht effektiver sind als Zeitvorgaben. Dass dieses nicht überall umsetzbar ist, steht außer Frage.
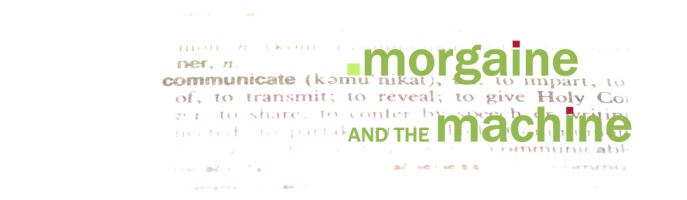

Trackback URL:
https://morgaine.twoday.net/stories/828728/modTrackback